Der Begriff „Klimaangst“ ging in den vergangenen Monaten durch die Medien. Ist dieses Phänomen durch die Forschung belegt?
Dr. Karen Hamann: Wenn wir Leute fragen, ob sie Angst vor der Klimakrise haben, dann sehen wir hohe Zustimmungsraten, insbesondere bei Jugendlichen. Wenn wir aber zum Beispiel eine klinisch angelehnte Skala anlegen, die misst, ob Menschen emotional und verhaltensbezogen durch die Klimakrise stark belastet sind, ist das meistens weniger der Fall. Klimaangst in diesem Sinne ist also kein psychisches Störungsbild, aber sie hat Anteile, die einer leichten Depression ähneln können.
Die Forschung zu diesem Thema wurde sicherlich auch von den Medien befeuert, ich habe es zumindest in meiner Laufbahn noch nie gesehen, dass ein Forschungsbereich in so kurzer Zeit so explodiert ist. Was uns in unserem Buch interessiert, ist aber die andere Seite der Medaille, nämlich wie die Leute ins Handeln kommen, was Protest und Engagement angeht.
Welche Auswirkungen hat denn Klimaangst auf das Engagement der Menschen? Wirkt sie eher aktivierend oder eher lähmend?
Ein gewisser Anteil unserer Bevölkerung zeigt stärkere Symptome von Klimaangst. Diese Menschen fühlen sich ängstlich, liegen vielleicht nachts wach. Vieles weist darauf hin, dass diese Angst dazu führt, dass Menschen eher versuchen, etwas gegen die Klimakrise zu tun. Allerdings gibt es dazu noch keine kausalen Studien, das muss man dazu sagen. Das heißt, es kann auch sein, dass diejenigen, die sich mehr engagieren und sich mehr mit diesen Themen beschäftigen, deswegen auch größere Ängste entwickeln.
In den Medien wird oft mit negativen Begriffen wie „Klimakollaps“ gearbeitet. Wie wirkt sich die öffentliche Berichterstattung auf unsere Haltung zur Klimakrise aus?
Ich würde sagen, es ist abhängig davon, ob man dem Publikum gleichzeitig ein Gefühl der Wirksamkeit und vielleicht auch der Hoffnung vermitteln kann oder ihm auch die Möglichkeit gibt, seine Wut zu äußern. Wenn wir mit angsterfüllten Botschaften konfrontiert werden und nicht wissen, was wir tun sollen, dann haben wir eher die Neigung, uns zurückzuziehen und gar nichts zu tun. Wir brauchen konstruktiven Journalismus, es braucht positive Geschichten, die die Leute auch motivieren. Ich habe letztens einen Film gesehen, der sich 88 Minuten lang um die Klimakrise drehte und darum, wie schlimm es wird. Erst in den letzten zwei Minuten wurde gesagt, wo es einen Funken Hoffnung gibt – dies ist nicht genug. Um wirklich aktiv zu werden, braucht es mehr als die Angst.
Was genau braucht es aus Sicht der psychologischen Forschung, damit wir uns für eine Sache einsetzen?
Über verschiedene Bereiche hinweg hat die Forschung drei Motivationssäulen für gesellschaftliches Engagement als essenziell ermittelt, die gelten auch im Klimaschutz.
Die stärkste Säule von allen ist die Identifikation mit sogenannten politisierten Gruppen. Dass ich mich zum Beispiel mit Fridays for Future identifiziere oder mit der Letzten Generation, aber vielleicht auch mit meiner lokalen Nachbarschaftsinitiative, die sich für Ökostrom einsetzt.
Die zweite Säule ist Moral und Wut: Wenn es mich wütend macht, dass es Ungerechtigkeiten gibt in der Bevölkerung oder dass die junge Generation irgendwie benachteiligt ist, dann bin ich eher bereit, auf die Straße zu gehen und mich zu engagieren.
Die dritte Säule ist die Wirksamkeit, also das Gefühl, dass wir als Kollektiv etwas erreichen können und dass ich als Individuum für das Kollektiv einen wichtigen Beitrag leiste.
Das sind die Motivationssäulen, mit denen wir uns in unserem Buch beschäftigen. Da gibt es viele Möglichkeiten, viele Ideen, auf denen Klimagruppen und Menschen, die sich engagieren wollen, aufbauen können.

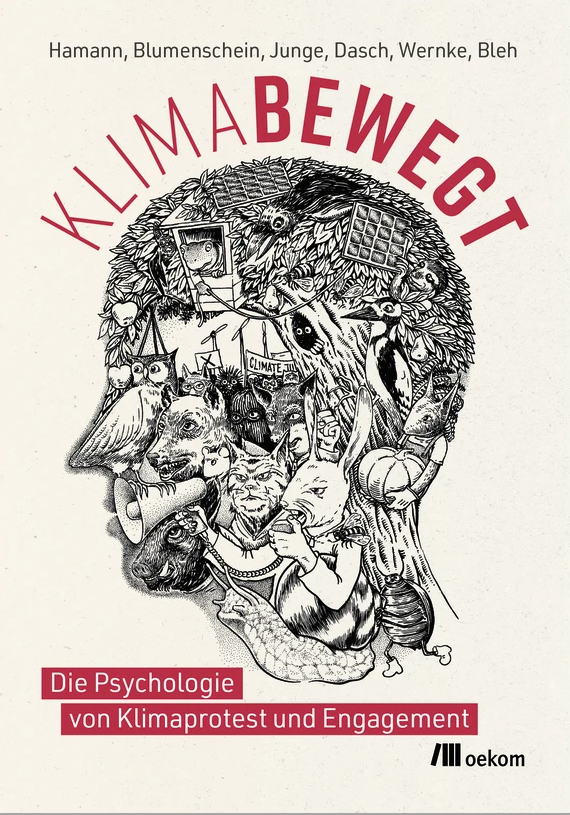
Kommentare
Keine Kommentare gefunden!