Hier setzt das Forschungsprojekt micDiv an. micDiv steht für microbial diversity (mikrobielle Vielfalt) und wurde von 2018 bis 2024 durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert und in enger Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) durchgeführt. Unter der Leitung von Prof. Dr. Martin Schlegel von der Universität Leipzig und Prof. Dr. Michael Bonkowski von der Universität Köln beprobte und analysierte das Team mit moderner Technik und molekularen Methoden Baumwipfel im Leipziger Auwald sowie in Papua-Neuguinea. Ziel war es, fehlendes Wissen über die Verbreitung der Mikroorganismen im Kronenraum zu generieren, sowohl für die gemäßigte als auch die tropische Klimazone. Dabei fanden die Forschenden nicht nur eine große Zahl unbekannter Arten, sondern auch Verteilungsmuster, mit welchen sie nicht gerechnet hatten.
Zur Untersuchung des Kronenraums der gemäßigten Klimazone kam der Leipziger Auwaldkran zum Einsatz, ein 33 Meter hoher Turmdrehkran inmitten des Auwaldes, der seit 2014 als Forschungsplattform von iDiv fungiert. Der Kran, welcher auf einer 120 Meter langen Schiene verläuft, verfügt über einen um 360 Grad schwenkbaren Arm mit einer kleinen Gondel. Von dieser aus wurden systematisch Proben des Kronendachs gesammelt.
In den Proben identifizierten die Forschenden Protisten. Das sind winzige Eukaryoten – also einzellige Lebewesen mit einem Zellkern, in dem die Erbinformationen gespeichert sind. Zu den Protisten gehören unter anderem kleine Algen, Amöben und andere winzige Organismen. Sie stellen eine evolutionär alte Gruppe dar, aus der alle heutigen Vielzeller wie Tiere, Pilze und Pflanzen hervorgegangen sind. Obwohl sie mikroskopisch klein sind, spielen sie eine große Rolle im Nahrungsnetz, indem sie andere Mikroorganismen fressen oder als Parasiten lebende Organismen angreifen und damit den Kreislauf von Nährstoffen in der Natur antreiben.


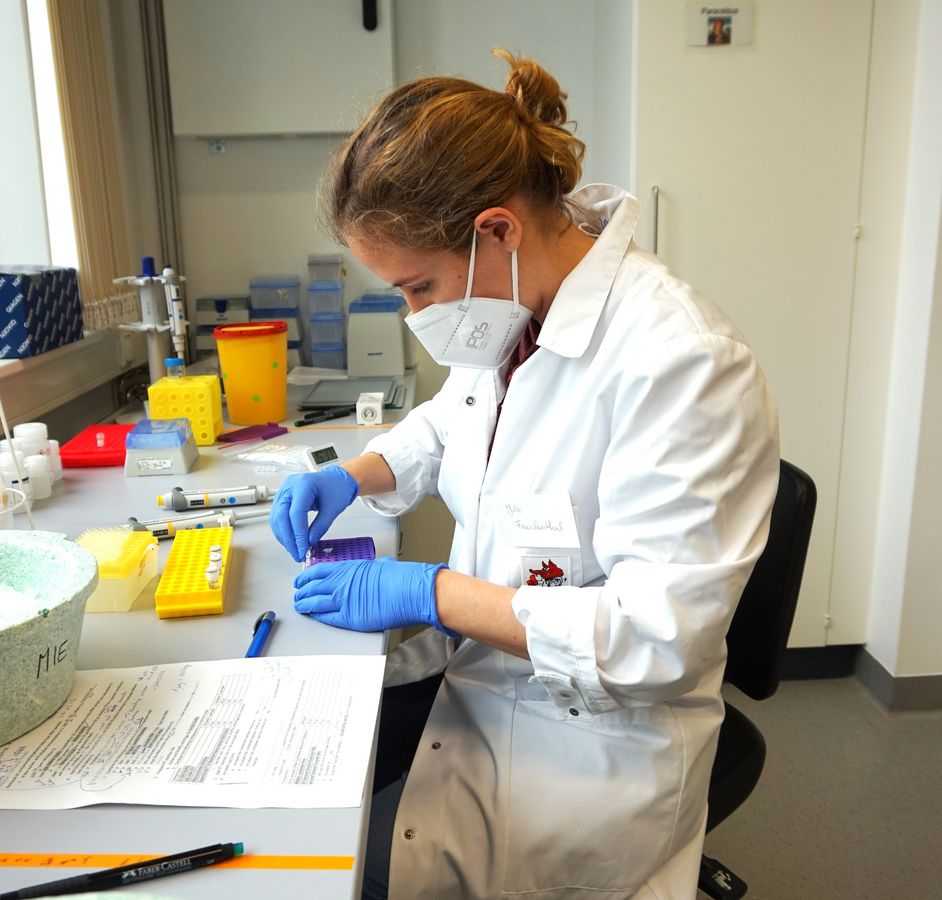

Kommentare
Keine Kommentare gefunden!